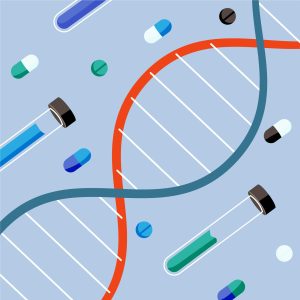Ein interdisziplinäres Team des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Universität Luxemburg hat festgestellt, dass eine Kombination kleiner Genvariationen, die die Mitochondrien, einen wichtigen Bestandteil menschlicher Zellen, regulieren, mit einem erhöhten Parkinson-Risiko einhergeht. Zum ersten Mal beobachteten die Forscher auch eine Übereinstimmung dieser genetischen Prognosen und den Merkmalen von Zellmodellen: Zellen von Patienten mit einem hohen Risiko-Score wiesen eine Störung der Mitochondrien auf. Anhand von Daten aus einer klinischen Studie, die von internationalen Partnern durchgeführt wurde, zeigten sie außerdem, dass Patienten mit einem hohen Risiko-Score besser auf eine Behandlung ansprachen, die auf die Mitochondrien abzielte. Diese Ergebnisse, die kürzlich in der Fachzeitschrift Annals of Neurology veröffentlicht wurden, ebnen den Weg für ein besseres Design klinischer Studien und werden die Präzisionsmedizin für die Parkinson-Krankheit maßgeblich beeinflussen.
Die Parkinson-Krankheit ist die am schnellsten zunehmende neurodegenerative Erkrankung, von der etwa 2 % der Bevölkerung über 60 Jahre betroffen sind. Das Verständnis der komplexen genetischen Struktur dieser Krankheit stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Familiäre Formen, die auf einer einzigen Genmutation beruhen, machen 5 bis 10 % aller Fälle aus. Genetische Faktoren tragen aber wahrscheinlich auch bei vielen anderen Patienten zur Erkrankung bei. Studien deuten darauf hin, dass eine Kombination kleiner Veränderungen, so genannter Varianten, in mehreren Genen einen Risikofaktor für die Erkrankung darstellen könnte. Um deren Einfluss genauer zu untersuchen, haben Forscher in den letzten Jahren sogenannte polygene Risiko-Scores entwickelt.
Polygenes Risiko: Die kombinierte Wirkung mehrerer Genvarianten messen
Hinter dem Konzept der polygenen Risiko-Scores steckt die Idee, das Risiko abzuschätzen, das sich aus der Summe der verschiedenen Genvarianten ergibt, die eine Person in sich trägt. „Die meisten gängigen Varianten haben keine oder nur geringe Auswirkungen. Wenn sie jedoch mit mehreren anderen kombiniert sind, können sie zusammen die Krankheit beeinflussen“, erklärt Dr. Patrick May, Forscher im LCSB Bioinformatics Core. Er leitete die genetische Analyse dieser Studie mit Dr. Zied Landoulsi, der weiter ausführt: „Wir verwenden statistische Methoden und groß angelegte genetische Studien, um zu verstehen, ob einzelne Varianten mit der Krankheit oder einem bestimmten Merkmal zusammenhängen. Indem wir die geschätzten Auswirkungen dieser kleinen Veränderungen in mehreren Genen addieren, können wir einen Risiko-Score berechnen und so Personen mit erhöhtem Parkinsonrisiko identifizieren.“
Darüber hinaus könnte ein solcher Ansatz bei heterogenen Krankheiten mit einem breiten Spektrum an beteiligten Genen und molekularen Mechanismen nützlich sein, um Patienten zu stratifizieren, also sie in verschiedene Gruppen einzuteilen. Dies würde die Einführung der sogenannten Präzisionsmedizin ermöglichen: Patienten mit einem hohen polygenen Risikoscore für Gene, die bestimmte biologische Funktionen regulieren, könnten besser auf Behandlungen ansprechen, die auf genau diese Funktionen abzielen.
Patienten mit defekten Mitochondrien identifizieren
„Es ist bekannt, dass die Mitochondrien, die die Energie in unseren Zellen erzeugen, eine Rolle bei der Parkinson-Krankheit spielen. Es gibt Hinweise darauf, dass ihre Fehlfunktion schon sehr früh auftreten und am Ausbruch der Krankheit beteiligt sein kann“, erklärt Prof. Anne Grünewald, Leiterin der Gruppe Molecular & Functional Neurobiology. „Wir haben daher an der Hypothese gearbeitet, dass bei einigen Patienten eine Kombination von Varianten in verschiedenen mitochondrialen Genen im Zellkern vorliegt. Dies wiederum trägt zum Prozess der Neurodegeneration bei.“
Durch die Analyse von Daten aus zwei großen und gut charakterisierten Kohorten, der Luxemburger Parkinson-Studie und COURAGE-PD, berechneten die Forscher Mitochondrien-spezifische polygene Risiko-Scores für mehr als 14.000 Patienten und Kontrollpersonen. Dabei zeigte sich, dass das Vorliegen mehrerer Mutationen in Genen, die eine Funktion der Mitochondrien, nämlich die oxidative Phosphorylierung (OXPHOS), regulieren, signifikant mit der Parkinson-Krankheit verbunden ist. „Diese ersten Ergebnisse stützen die Annahme, dass eine veränderte mitochondriale Atmung ein wichtiger Faktor der Parkinson-Krankheit ist“, erklärt Dr. Giuseppe Arena, Forscher in der Translational Neuroscience Gruppe und einer der Erstautoren der Studie. „Sie weisen auch darauf hin, dass polygene Risiko-Scores ein nützliches Instrument für die genetische Stratifizierung von Patienten sind, mit dem wir zuverlässig diejenigen identifizieren können, die Veränderungen in den Mitochondrien aufweisen.“
Genetischen Scores im Labor bestätigen
Als Nächstes wollten die Forscher herausfinden, ob die berechneten Risiko-Scores mit bestimmten Merkmalen in den Zellen der Patienten übereinstimmen. Sie führten mehrere Tests mit Hautzellen durch, die von Teilnehmern der Luxemburger Parkinson-Studie gespendet wurden, sowie mit Nervenzellen, die im Labor aus diesen Hautproben gewonnen wurden. In beiden Fällen beobachteten sie nennenswerte Unterschiede in der mitochondrialen Atmung zwischen Zellen von Personen mit hohen und niedrigen Risiko-Scores. „Unsere Studie bestätigt zum ersten Mal auf diesem Gebiet, dass es Zellprofile gibt, die den genetischen Risiko-Scores entsprechen“, betont Dr. Arena.
Relevant für klinische Studien
Im letzten Teil der Studie untersuchte das Team, ob die Verwendung von polygenen Risiko-Scores zur Stratifizierung von Patienten dazu beitragen könnte, d.h. um Personen zu identifizieren, die besser auf Medikamente ansprechen, die gezielt auf die Mitochondrien abzielen. Zu diesem Zweck teilten die Forscher die Teilnehmer einer britischen Studie retrospektiv nach denselben Risiko-Scores ein. Die Studie unter der Leitung von Prof. Bandmann von der Universität Sheffield und Prof. Foltynie vom University College London konzentrierte sich auf die Behandlung mit einem Wirkstoff, von dem bekannt ist, dass er die Funktion der Mitochondrien wiederherstellt. Die Ergebnisse zeigten, dass Patienten mit einem hohen Risiko-Score besser auf die Behandlung ansprachen. Dies untermauert das Potenzial dieses Ansatzes für die genetische Stratifizierung in klinischen Studien.
„Es ist ermutigend zu sehen, dass die Verwendung von Mitochondrien-spezifischen Risiko-Scores es ermöglichen wird, homogenere Patientengruppen für klinische Studien zu erstellen, die besonders auf die Mitochondrien abzielen“, betont Prof. Anne Grünewald. „Es handelt sich um ein neues, präzises Instrument zur Identifizierung von Patienten, die am meisten von solchen zielgerichteten Therapien profitieren werden. Da die mitochondriale Dysfunktion häufig mit einem frühen Ausbruch der Krankheit einhergeht, könnten zudem Personen mit besonders hohem Risiko in Zukunft von präventiven Behandlungen profitieren.“
„Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt für die Präzisionsmedizin bei der Parkinson-Krankheit und daher besonders relevant für Forscher, die sich mit der Umsetzung von Grundlagenforschung in konkrete therapeutische Maßnahmen beschäftigen“, sagt Prof. Rejko Krüger, Leiter der Translational Neuroscience Gruppe und Koordinator des National Centre for Excellence in Research on Parkinson’s Disease, abschließend. „Diese Ergebnisse wurden durch die Luxemburger Parkinson-Studie ermöglicht, deren Design nicht nur ein genetisches Screening, sondern auch funktionelle Analysen von Zellen derselben Patienten erlaubt. Die auf diesen Risiko-Scores basierende Einteilung der Patienten in Untergruppen wird neue Zusammenarbeiten mit Partnern ebnen, die gezielte Wirkstoffe testen wollen, um das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.“
—
Referenz: Giuseppe Arena, Zied Landoulsi, Dajana Grossmann, Thomas Payne, Armelle Vitali, Sylvie Delcambre, Alexandre Baron, Paul Antony, Ibrahim Boussaad, Dheeraj Reddy Bobbili, Ashwin Ashok Kumar Sreelatha, Lukas Pavelka, Nico Diederich, Christine Klein, Philip Seibler, Enrico Glaab, Thomas Foltynie, Oliver Bandmann, Manu Sharma, Rejko Krüger, Patrick May and Anne Grünewald, Polygenic risk scores validated in patient-derived cells stratify for mitochondrial subtypes of Parkinson’s disease, Annals of Neurology, 20 May 2024.
Referenz der klinischen Studie: EudraCT no. 2018–001887-46
Finanzierung: Diese Studie wurde vom Luxembourg National research Fund (FNR) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Mehr über die Forscher
Top image designed by Freepik