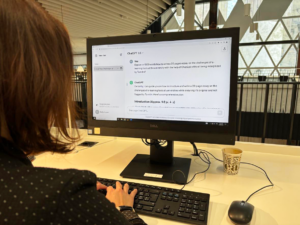ChatGPT, Copilot oder Gemini: KI-Tools zur Gestaltung und Anreicherung von schriftlichen Berichten werden bei Studierenden immer beliebter. Aber wie können Lehrer diese Art von Arbeit bewerten?
Antworten auf solche Fragen finden Lehrerinnen und Lehrer jetzt in einem speziellen Fortbildungskurs an der Universität Luxemburg. Das erste der fünf für das laufende Semester geplanten Seminare war sofort ausgebucht, und das Tempo der Anmeldungen für die weiteren Ausgaben zeugt von einem starken Interesse der Lehrkräfte.
„Es ist nicht möglich, ChatGPT zu verbieten, und seine Verwendung kann durch den Einsatz anderer KI-Tools, die Inhalte umformulieren, unentdeckbar werden„, erklärt Margault Sacré, E-Learning-Spezialistin. Selbst das Plagiatserkennungsprogramm Turnitin kann nichts gegen die Tricks der KI ausrichten, wenn ein von ChatGPT geschriebener Text durch die Hände eines Synonymgenerators gegangen ist. „Meiner Meinung nach, sollte man damit beginnen dass die Schüler anerkennen, dass sie die KI verwendet haben, indem sie am Ende der Seite darauf hinweisen„, schlägt sie vor. Einige Lehrerinnen und Lehrer fragen zum Beispiel nach den Prompts.
In aller Offenheit
„Das Seminar hat es mir ermöglicht, die Studierenden für generative KI-Tools zu sensibilisieren, insbesondere dafür, dass diese Tools zwar leistungsstark sind, ihre Verwendung aber eine gewisse Vorsicht erfordert„, erklärt Cedric Laczny, Forscher an der Universität Luxemburg. Er, der dafür zuständig ist, den Studierendenzu erklären, wie man Berichte, insbesondere über wissenschaftliche Themen, schreibt und diese Arbeiten korrigiert, verlangt nun von den Studierenden, dass sie Ressourcen aus generativer KI-Software und Details zur Interaktion mit dieser Software als Anhang beifügen.
Er ist sich bewusst, dass „eine faire Bewertung darin besteht, die Studierenden nach etwas zu fragen, was sie gelernt haben„, und räumt nun ein, dass die Berücksichtigung des Einsatzes von KI ihn dazu veranlasst, die Struktur der Kurse zu überdenken. Er weist darauf hin, dass „KI zwar als zeitsparend angesehen werden kann, aber auch Zeit kostet, wenn es um die Handhabung der Tools und die Überprüfung der generierten Antworten geht„.
Denn indem eine Lehrkraftdie Studierenden befragt, wie die KI ihnen geholfen hat, den geforderten Inhalt zu produzieren, kann diese auch beurteilen, wie gut sie das Thema beherrschen. Die Rückkehr zu mündlichen Prüfungen oder schriftlichen Tests ist also nicht unbedingt die Lösung für die von ChatGPT und seinen Konkurrenten gestellte Unterstützung.
Margault Sacré hat nicht vor, es dabei zu belassen: Sie bereitet für das nächste akademische Jahr ein Schulungsprogramm mit fünf spezifischen Themen für Hochschullehrkräfte rund um die Werkzeuge der generativen KI vor. Weit entfernt vom Klischee des Schummelns kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch die Tür zu deren tatsächlicher Beherrschung öffnen.
‟ Meiner Meinung nach, sollte man damit beginnen dass die Schüler anerkennen, dass sie die KI verwendet haben, indem sie am Ende der Seite darauf hinweisen.”
© Foto: Universität Luxemburg