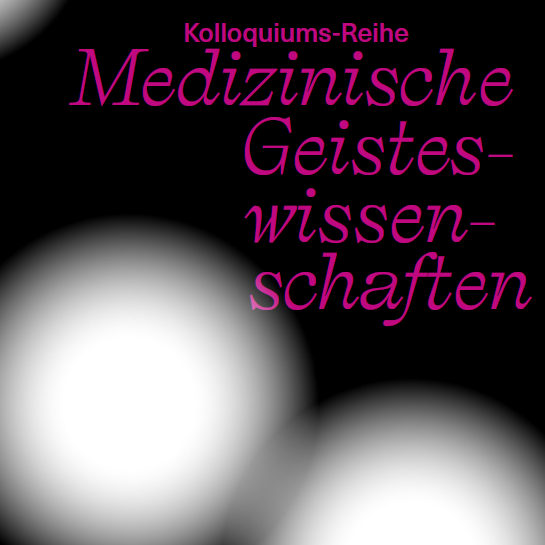Konzept der Kolloquiums-Reihe
Expert:innenvorträge aus den Bereichen der Neurologie, Literaturwissenschaft und Medizingeschichte vermitteln an ausgewählten Beispielen (wie der rezenten Demenz- und Epilepsieforschung) einen Überblick über den Themenschwerpunkt Literatur und Neurologie. Ziel des Kolloquiums ist es, einen interdisziplinären, in den öffentlichen Raum ausstrahlenden Dialog zu initiieren, bei dem es – im besten Fall – zu einer wechselseitigen Erhellung der jeweiligen Wissensbestände und -geschichte kommt. Eingeladen zur Teilnahme an der Kolloquiums-Reihe sind all diejenigen, die sich durch das Sujet angesprochen fühlen und/oder glauben, es durch ihre fachwissenschaftliche Sicht vertiefen und bereichern zu können.
Thematischer Fokus
Nachdem es in der Auftaktveranstaltung der Medizinischen Geisteswissenschaften (MGW) im März 2023 vor allem darum ging, die Voraussetzungen und Perspektiven für das Verhältnis zwischen Geisteswissenschaften und Medizin in Luxemburg zu diskutieren, sollen von nun an Schwerpunktthemen behandelt werden, die Dimensionen und Facetten dieses Forschungsfeldes exemplarisch in den Blick rücken.
Dass die Reihe sich dieses Mal mit Fragen beschäftigt, die sich im Bezugsrahmen von Literatur und Neurologie bewegen, hängt unter anderem mit der Intensität zusammen, mit der sich in den letzten Jahren Neuro- und Literaturwissenschaft aufeinander zubewegt und sich dabei vor allem für die Schnittstelle zwischen Gehirnfunktion und literarischen Erfahrungen interessiert haben. Unter anderem wurden Erkenntnisse der Neurowissenschaften genutzt, um zu verstehen, wie literarische Texte das Gehirn beeinflussen und wie neuronale Mechanismen die Sprachverarbeitung und das Verständnis komplexer narrativer Strukturen unterstützen. Studien haben beispielsweise gezeigt, dass das Lesen von Literatur spezi sche Gehirnregionen aktiviert, darunter die visuellen Verarbeitungszentren, das Sprachverarbeitungsnetzwerk und emotionale Zentren wie das limbische System. Umgekehrt wurde und wird mit Blick auf die Literatur der Frage nach der Präsenz neurologischer Phänomene in literarischen Werken nachgegangen, nach ihren historischen Aneignungen, ihren thematischen und ästhetischen Umsetzungen wie auch ganz grundsätzlich nach der Beziehung von medizinischem und literarischem Wissen. Das diesbezügliche Interesse der Schriftsteller:innen ist weitgespannt und gilt mit bestimmten zeitlichen und regionalen Akzentuierungen dem gesamten ‚Kosmos der Neurologie‘.
Im Kolloquium werden insbesondere die neurologischen Krankheitphänomene Demenz, Epilepsie und Migräne thematisiert.
Veranstalter:innen: amelie.bendheim@uni.lu; dieter.heimboeckel@uni.lu
Programm
Moderation: Amelie Bendheim & Dieter Heimböckel
-
14:00-14:20
Begrüßung durch die Veranstalter:innen
-
14:20-15:00
Demenz als Herausforderung für Medizin und Gesellschaft
Prof. Dr. Michael Heneka, Direktor des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB), Universität Luxemburg -
15:00-15:40
Über das Schreiben vom Leben mit einem Glioblastom: Zu Wolfgang Herrndorfs „Arbeit und Struktur“ (2013)
Prof. Dr. Florian Steger, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm -
15:40-16:20
Zum Krankheitsdiskurs in der Schule. Über die Notwendigkeit einer humanwissenschaftlichen und medizinischen Interaktion
Dr. Claude Heiser, Schulleiter des Athénée de Luxembourg -
16:40-17:20
Die Darstellung von Epilepsie in den Printmedien
PD Dr. Stefan Beyenburg, Chefarzt der Neurologie, Centre Hospitalier de Luxembourg -
17:20-18:00
Wenn der Kopf macht, was er will. Migräne und Epilepsie in der Literatur
Prof. Dr. Anne-Marie Millem & Prof. Dr. Dieter Heimböckel, Literaturwissenschaftler:innen, Institut für
deutsche Sprache, Literatur und für Interkulturalität / Institute of English Studies, Universität Luxemburg -
18:00-18:30
Abschlussrunde