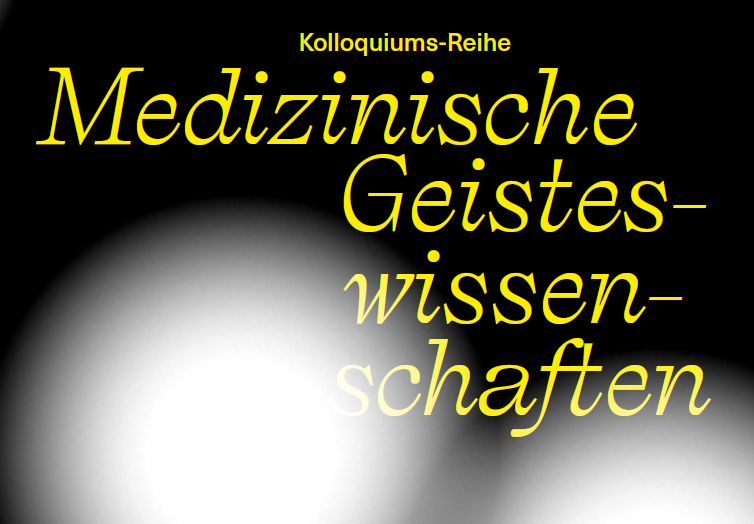Konzept
Expert:innenvorträge aus den Bereichen der Neurologie, Literaturwissenschaft und Medizingeschichte vermitteln an ausgewählten Beispielen (wie der rezenten Demenz- und Epilepsieforschung) einen Überblick über den Themenschwerpunkt Literatur und Neurologie. Ziel des Kolloquiums ist es, einen interdisziplinären, in den öffentlichen Raum ausstrahlenden Dialog zu initiieren, bei dem es – im besten Fall – zu einer wechselseitigen Erhellung der jeweiligen Wissensbestände und -geschichte kommt.
Eingeladen zur Teilnahme an der Kolloquiums-Reihe sind all diejenigen, die sich durch das Sujet angesprochen fühlen und/oder glauben, es durch ihre fachwissenschaftliche Sicht vertiefen und bereichern zu können.
Thematischer Fokus
Die Kolloquiums-Reihe der Medizinischen Geisteswissenschaften geht nach ihrem Auftakt im März 2023 nunmehr in die dritte Runde. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf Literatur und Sucht.
Sucht ist mehr denn je ein zentrales gesellschaftliches Thema, das weit über klassische Substanzabhängigkeiten hinausgeht. Neben Alkohol, Nikotin und Drogen stehen zunehmend Verhaltenssüchte wie Medien-, Spiel-, Konsum- oder Arbeitssucht im Fokus. In einer leistungsorientierten, digitalisierten und schnelllebigen Gesellschaft fungiert Sucht oft als Symptom für Überforderung, Einsamkeit oder psychische Instabilität. Zugleich werden Prävention, Entstigmatisierung und die Verbindung von Sucht mit mentaler Gesundheit immer wichtiger – sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in der Politik und Gesundheitsversorgung. Dabei wurde Sucht historisch lange als moralisches Versagen gedeutet. Erst im 19. Jahrhundert begann man, sie medizinisch zu verstehen. Mit der Moderne wuchs allmählich das Bewusstsein für psychische und soziale Ursachen. Von dieser Entwicklung legt auch die Literatur Zeugnis ab.
Sucht tritt literarisch als vielschichtiges und komplexes Thema in Erscheinung, das in vielen Fällen auch das Schreiben selbst prägt: als Ausdruck eines inneren Ungleichgewichts, als Impuls für ästhetische Verdichtung oder als Suche nach Grenzerfahrung und Selbstauflösung. Gleichzeitig spiegeln literarische Texte die gesellschaftlichen Bilder und Deutungsmuster von Sucht. Sie bewegen sich zwischen Pathologisierung und Romantisierung, zwischen individueller Krise und kulturellem Symptom. In der Auseinandersetzung mit süchtigen Existenzen verhandelt Literatur grundlegende Fragen nach Subjektivität, Kontrolle, Abhängigkeit und Transzendenz – oft jenseits rein medizinischer oder moralischer Zuschreibungen.
Das Kolloquium möchte diesen Perspektiven Raum geben. Es erkundet die Lesbarkeit des an sich ‚unlesbaren‘ Begriffs der Sucht (Resch: Provoziertes Schreiben, 2007) und geht exemplarisch ihren literarischen Ausprägungen in Vergangenheit und Gegenwart nach, wobei im Mittelpunkt nicht nur die Überlegung stehen soll, wie Literatur Sucht darstellt, sondern auch: wie bzw. inwiefern sie als Ort der Reflexion über das Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Sprache wahrgenommen werden kann.
Programm
-
13:30-14:00
Empfang
-
14:00-14:30
Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Dieter Heimböckel (Germanistik, Universität Luxemburg) -
14:30-15:15
Verhaltenssüchte, oder wenn das Verlangen nach Essen, einem schlanken Körper oder dem
Internet krank macht
Prof. Dr. Claus Vögele (Clinical and Health Psychology, Universität Luxemburg) -
15:15-16:00
Übel der trinket ze aller stunden. Alkoholsucht aus literarhistorischer Perspektive
Prof. Dr. Amelie Bendheim (Germanistik, Universität Luxemburg) -
16:00-16:30
Kaffee-Pause
-
16:30-17:15
Literatur als Sucht. Hungersucht, Eifersucht und Sehnsucht in Thomas Manns Erzählungen Die Hungernden und Tonio Kröger
Dr. Claude Heiser (Athénée du Luxembourg / Germanistik, Universität Luxemburg) -
17:15-18:00
Sucht und das Nicht-Menschliche am Beispiel von Joan Slonczewskis Brain Plague (2000)
Prof. Dr. Davina Höll (Gender und Diversitätsforschung, Tübingen) -
18:00
Abschlussdiskussion
Veranstalter:innen