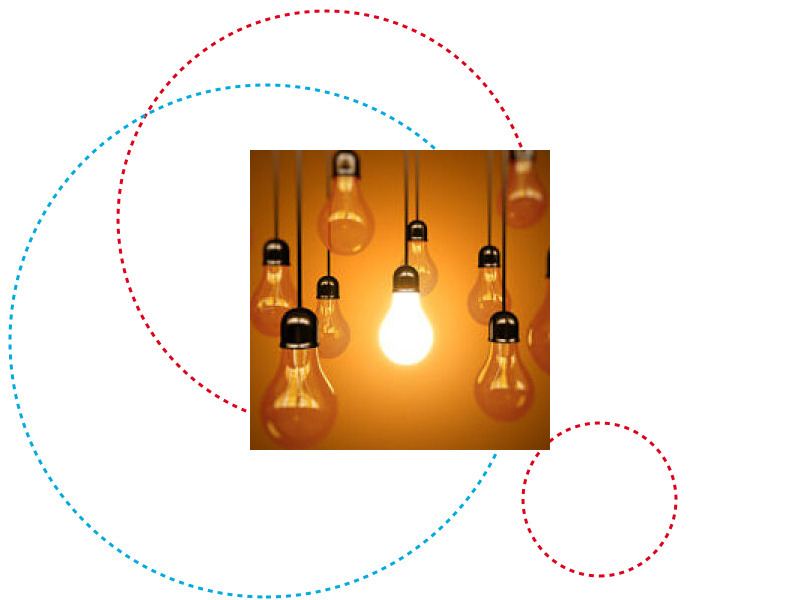Dass „das Problem vom Werte der Wahrheit“ seit langem, und nicht erst seit der Ausbreitung der sogenannten „fake news“ und deren verhängnisvollen politischen Auswirkungen aufgetreten ist, bedarf keiner längeren Erörterungen. Fraglich ist vielmehr, ob es sich um ein wirkliches Problem und nicht ein um Scheinproblem handelt, gleichsam als ob die Formel „p ist wahr“ nicht mehr als eine Höflichkeitsbezeugung gegenüber den Sätzen, mit denen wir einverstanden sind, wäre.
Nietzsches Metapher des „Stelldicheins von Fragen und Fragezeichen“ ist keine unverbindliche rhetorische Floskel. Sie lädt uns vielmehr dazu ein, uns zu fragen, ob der primäre Gegenstand dieses Stelldicheins nur ein intellektuelles Problem ist, oder eher ein existentielles Urphänomen darstellt, das innerlich mit dem In-der-Welt-sein des Menschen zusammenhängt. Darüber hinaus lädt sie uns dazu ein, die Analyse des „Phänomens der Wahrheit“ mit der Frage nach der Tugend der Wahrhaftigkeit zu verklammern, anders gesagt, Nietzsches Fragen „Wieviel Wahrheit erträgt ein Geist?“ und „Wieviel Wahrheit wagt ein Geist?“ als die beiden Brennpunkte ein und derselben phänomenologisch-hermeneutischen Ellipse zu betrachten.
Blicken wir von hier aus auf die Gegenwartsphilosophie, dann haben wir gute Gründe, uns mit B. Williams zu fragen, ob die gegenseitige Stabilisierung der Begriffe „Wahrheit“ und „Wahrhaftigkeit“ nicht immer noch ein Grundproblem der Philosophie ist. Wenn die Wahrheit nicht mehr das ist, worauf es ankommt, schwebt die Tugend der Wahrhaftigkeit gleichsam ohne Bodenhaftung in einem luftleeren Raum.
Jeder von uns trägt einen kleinen Narziss in sich, der sich selbst bewundert und bewundert sein will, und auch einen kleinen hinterhältigen und ränkeschmiedenden Machiavelli. Nichts deutet darauf hin, dass wir spontan geneigt sind, ein anderer zu werden. Eine grundsätzliche Besinnung auf die Rolle, die der Wahrheitsbegriff beim Verstehen der Sprache und dem Verstehen anderer Menschen spielt, zieht unweigerlich die Frage nach sich, welche Tugenden und Praktiken dem Anliegen, die Wahrheit zu sagen, zugrunde liegen.
Eine hermeneutische Neubesinnung auf die drei Haupttugenden der Aufrichtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der Authentizität verwandelt den die Moderne kennzeichnenden Hexenkreis von Selbstbehauptung und Selbstzerstörung in einen fruchtbaren hermeneutischen Zirkel.
Vortrag im Rahmen des Vortragszyklus der Arbeitsgruppe „Geisteswissenschaften und Religion“.
Eine Teilnahmebestätigung wird auf Wunsch ausgestellt.
Kontakt: Jean-Marie Weber